Ida Kramer, Posamenterin

Ida Kramer, Copyright und Bildquelle: Theater ex/ex
Anhand der fiktiven Figur der Ida Kramer, Posamenterin und Arbeiterin in der Arlesheimer Schappe Spinnerei, lässt das Theater ex/ex die Geschichte der Industrialisierung aufleben. Das Theaterstück feierte letztes Jahr Première und wird nun wieder auf dem Areal des ehemaligen Walzwerks in Münchenstein aufgeführt.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts standen in den Baselbieter Häusern rund 4'700 Webstühle an denen bis zu 10'000 Menschen arbeiteten. Die Familien mieteten den Webstuhl von Fabrikanten. 16 bis 18 Stunden am Tag stellten Frauen, Männer und Kinder gemeinsam Seidenbänder für die Fabrikanten aus Basel her. Um 1830 entseht mit der Schappe Spinnerei in Arlesheim die erste Fabrik im noch jungen Kanton Baselland. Nach und nach wird die Heimarbeit der Seidenbandweber, der Posamenter, abgelöst durch die Arbeit in der Schappe-Fabrik, wo der die Seidenkokons zusammenhaltende Seidenleim ausgekocht wird um daraus Schappegarn zu produzieren. Während fast 150 Jahren hatte die Schappe einen wichtigen Teil der Geschichte Arlesheims gebildet. 1977 wurde die Fabrik geschlossen.
Ida Kramer arbeitet schon als Kind im Elternhaus als Posamenterin bei der Herstellung von Seidenbändern mit. Später findet sie Arbeit in der Arlesheimer Schappe Spinnerei. Schon bald beginnt sich Ida Kramer gegen die Zustände in der Fabrik zu wehren und setzt sich für das vom Bund 1877 verabschiedete eidgenössische Fabrikgesetz ein, das wesentliche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen vorsah: maximal 11 Stunden Arbeit pro Tag, Haftpflicht der Unternehmer für Unfälle und Berufskrankheiten, Arbeitsverbot bis acht Wochen nach der Geburt eines Kindes und Verbot der Kinderarbeit waren die Eckpfeiler des Fabrikgesetzes, gegen welches die Unternehmer das Referendum ergriffen. Die Theaterfigur Ida Kramer erlebt die Errungenschaften des neuen Gesetzes nicht mehr, sie wird von ihrem Vorgesetzten umgebracht, weil sie ihm auf die Schliche kommt, dass er seit Jahren Geld unterschlägt, das für eine Notfallkasse zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorgesehen gewesen wäre. Die ehemalige Arlesheimer Schappe Spinnerei wich einer Überbauung; Ida Kramer geistert daher im Münchenstein, auf dem Areal der ehemaligen Aluminiumfabrik herum und lässt die Industriegeschichte aufleben. Quelle
Wäre da nicht Ida Kramer … Geschichten von Patrons und anderen Working Class Heroes. Wiederaufnahme des Stückes im ehemaligen Walzwerk in Münchenstein. Rund um die fiktive Figur der Ida Kramer erhalten Zuschauerinnen und Zuschauer Einblick in die historischen Arbeitswelten aus drei Jahrhunderten.
Vorstellungsdaten: ab 7. August 2008 bis 31. August 2008 jeweils donnerstags bis sonntags.
- Siehe auch: SCHAPPE. Die erste Fabrik im Baselbiet. Ein Porträt. Katalog zur Ausstellung in der Trotte Arlesheim vom 12.3. bis 27.6.1993
wanderer - 8. Aug, 10:13




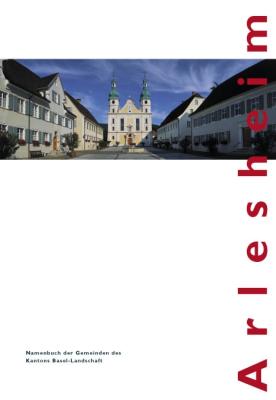












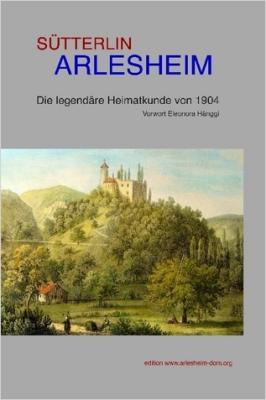
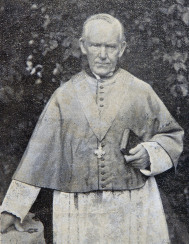
 Der Betreiber der privaten Arleser Domseite hat die 1907 erschienene Heimatkunde des Dorfes und der Pfarrei Arlesheim, verfasst von
Der Betreiber der privaten Arleser Domseite hat die 1907 erschienene Heimatkunde des Dorfes und der Pfarrei Arlesheim, verfasst von 